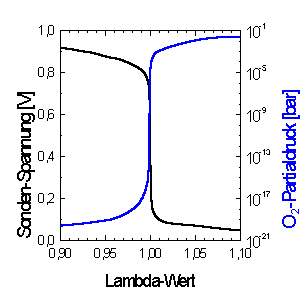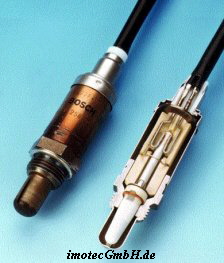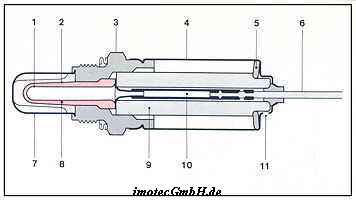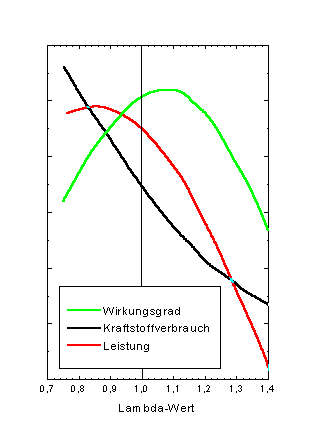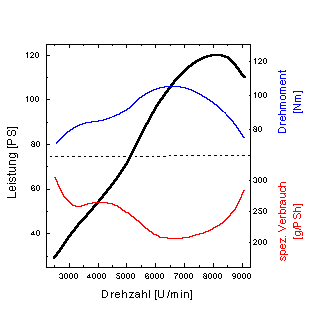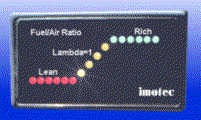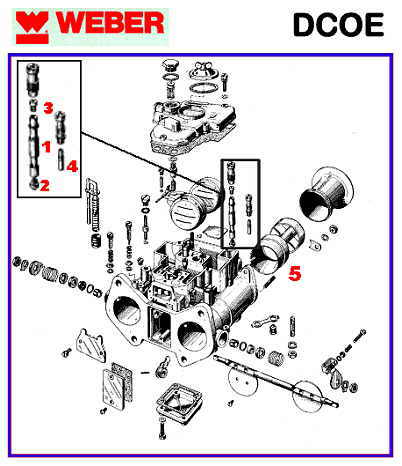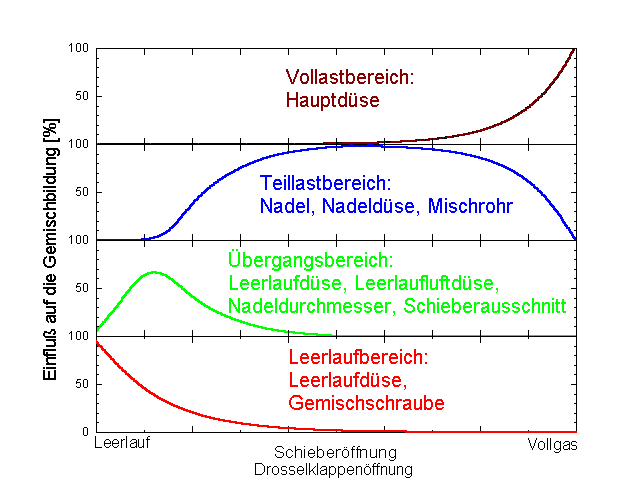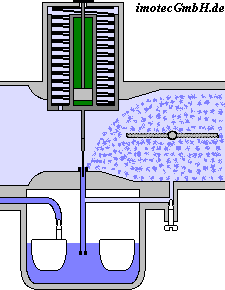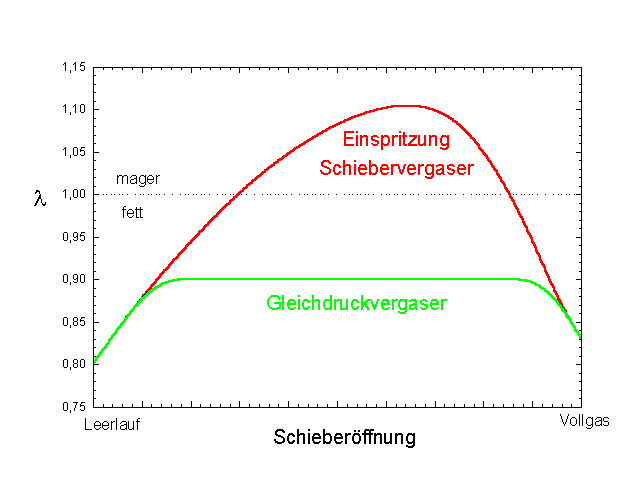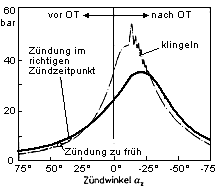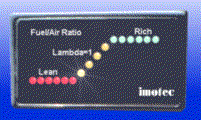|

|
|
Warum Abstimmen?
Weil die richtige
Abstimmung von Vergaser- oder Einspritzanlage einen grossen Einfluss auf Motorleistung, Sprit- verbrauch und Schadstoffausstoss hat und weil geänderte Motoren ohne Neuabstimmung früher oder später garantiert explodieren !
|
|
|
|
|

|
|
Wozu braucht man über-
haupt eine Lambdasonde?
Zur Bestimmung des
aktuellen Gemisches. Bei Katalysator-Motoren ist der Motorsteuerung ein elektronischer Regelkreis nachgeschaltet, der das Gemisch immer im sogenannten Katalysatorfenster bei l =1 hält.
Bei Motoren
ohne Katalysator hilft die Sonde jedoch auch bei der Vergaser- bzw. Einspritzanlagen-Abstimmung. Es geht dann jedoch nicht mehr darum den Lambda-Wert konstant bei eins zu
|
|
halten, sondern dem Motor last- und drehzahlabhängig ein für seine Betriebsbedingungen optimales Gemisch zuzuführen. Dieses Gemisch liegt allerdings in den seltensten Fällen bei l=1. Man benötigt hierfür eine
Anzeige des Lambda-Wertes, z.B. unseren “Lambda-Indicator”, und kann dann dadurch im realen Fahrbetrieb Aufschluss über die Abstimmung von Vergaser- oder Einpritzanlage
erhalten.
|
|
|

|
|
Die Sondenfunktion.
Die Sonde ist
ein potentiostatischer Sensor und besteht aus zwei Platin(Pt)-Elektroden, die durch eine Festelektrolyt getrennt sind. Die aktive Pt-Elektrode steht mit dem Abgas in Kontakt und an ihr findet eine
katalytische Reaktion statt, bei der sich Sauerstoff-Ionen bilden. Das Elektrolyt (üblicherweise Yttrium stabilisiertes Zirkondioxid, kurz YSZ) ist ein Ionen- leiter für Sauerstoffionen. Durch die
Ionenwanderung entsteht dann eine Spannung 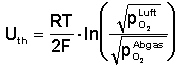 zwischen den Elektroden (Nernst-Gleichung), die direkt gemessen werden kann. Und was gemessen werden kann, dass ... zwischen den Elektroden (Nernst-Gleichung), die direkt gemessen werden kann. Und was gemessen werden kann, dass ... |
|
|
|
|

|
|
Die Sondenoptik.
Es gibt Planarsonden und
Fingersonden, wobei im KFZ-Bereich fast nur Fingersonden zum Einsatz kommen. Die meisten Fingersonden verwenden eine sehr ähnlich Bauform. Hier sind einmal die Typen von NTK
und Bosch abgebildet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Das Einschraubgewinde
in den Krümmer ist üblicherweise ein M18x1,5 Gewinde. Die Sonden sind in verschiedenen Ausfüh- rungen zu bekommen, die sich in der Anzahl der Anschlussleiter unterscheiden:
Zum Inhaltsverzeichnis
 |
|
- 1 Kabel: Signalkabel, Masse über Gehäuse
- 2 Kabel: Masse als Leiter herausgeführt
- 3 Kabel: eingebaute Heizung, Masse über Gehäuse
- 4 Kabel: eingebaute Heizung, Masse als Leiter
|
|
|

|
|
Der Sondenaufbau.
Die im KFZ-Bereich am
meisten verwendete Fingersonde zum Verständnis nachfolgend aufgeschnitten als Zeichnung abge- bildet.
|
|
|
|
|
|
|
1 = Elektrode (+)
2 = Elektrode (-)
3 = Gehäuse (-)
4 = Schutzhülle (luftseitig)
5 = Tellerfeder
6 = elektrischer Anschluss
7 = Schutzrohr (Abgasseitig)
8 = Sondenkeramik
9 = Stützkeramik
10 = Kontaktteil
11 = Belüftungsöffnung
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
Die Motorleistung
und der Spritverbrauch:
In jedem
Umdrehungs-Zyklus saugt der Motor eine bestimmte Gemischmenge an. Die Energie, die bei der Verbrennung dieser Menge entsteht bestimmt das aktuelle Drehmoment des Motors, aus dem sich mit der Drehzahl die
Leistung ergibt. Bei gegebener Drehzahl wird die Leistung daher direkt Über den Energieinhalt der Zylinderfüllung bestimmt. Erhöht man die Sprittmenge im Gemisch (Fett), dann reicht der Sauerstoffgehalt
zwar nicht mehr für eine vollständige Verbrennung aus, der Energieinhalt steigt jedoch etwas. Daher ergibt sich im fetten Bereich bei l
~0,85 die beste Leistung eines Motors. Bei weiterer Anfettung verringert sich die Leistung
wieder, da der zusätzliche Sprit nicht mehr verbrannt werden kann. Dadurch verringert sich dann wieder die Leistung, jedoch bewirkt das eine weitere Kühlung des Motors.
Mehr Sprit in einer
Zylinderfüllung bedeutet jedoch auch mehr Spritverbrauch bei gegebener Drehzahl. Anders herum verringert eine Gemischabmagerung den Spritverbrauch dras- tisch.
Bei einer leichten Abmagerung des Gemisches (l
>1) findet eine sehr vollständige Verbrennung statt, die für hohe Verbrennungstemperaturen sorgt. Die stärkere thermische Ausdehnung der Zylinderfüllung sorgt für einen weichen und langsamen Leistungsabfall.
|
|
Beispiel: Kawasaki Z1300 |
|
|
Möchte man nun die
maximale Leistung aus einem Liter Sprit bekommen, so muss man die Leistung pro Verbrauch be- stimmen und erhält den sog. Wirkungsgrad. Dieser Wirkungs- grad zeigt sein Maximum bei l
~1,1. Mit dieser Einstellung lässt sich ein Motor am spritsparendsten bewegen.
Der Benzinverbrauch eines Motors hängt jedoch auch sehr stark von der Auslegung und dem Wirkungsgrad des Motors selber
ab. Im unteren Drehzahlbereich treten hohe Spülverluste auf, die den Füllungsgrad des Brennraums verringern und für geringeres Drehmoment und höheren spezi- fischen Verbrauch sorgen. Dazu kommt,
dass in diesem Bereich die Ansaug-Strömungsgeschwindigkeit sehr gering ist und zu schlechter Gemischbildung führt, die durch Anfettung ausgeglichen werden muss. Das treibt den spezifischen Ver- brauch
zusätzlich wieder hoch.
Die beste Zylinderfüllung und damit auch das maximale Drehmoment sorgen auch für die beste Treibstoffausnutzung. Dazu kann der Motor gerade in diesem Bereich sehr
effektiv angestimmt werden. Im obersten Drehzahlbereich treten dann verstärkt Strömungsverluste auf und das Gemisch muss zur Motorkühlung auch wieder fetter werden. Das treibt den spezifischen Verbrauch
zwar leider wieder etwas hoch, ist allerdings für die Haltbarkeit des Motor ausserordentlich wich- tig.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
Das Abgasverhalten:
Bei einer idealen Verbrennung entstehen "nur" CO2 und Wasserdampf, aber die Verbrennung läuft nicht optimal ab. Schuld daran ist zum einen die Gemischhomogenität: Vergaser- oder Einspritzanlage erzeugen fein verteile Spritttröpfchen in der Ansaugluft. An diesen Tröpfchen ist das Gemisch daher fett, zwischen ihnen dagegen zu mager. Durch konstruktive Massnahmen am Motor versucht man das Gemisch gut zu verwirbeln und baut z.T. dazu noch Quetschkanten im Brennraum um ein homogenes Gemisch zum Zündzeitpunkt zu erhalten. Zum anderen besteht das Gemisch nicht nur aus Sprit und Sauerstoff, sondern aus Luft, die zu 78% aus Stickstoff besteht. Unter hohen Temperaturen kann nun der Sauerstoff auch mit dem Stickstoff reagieren. Dieser Sauerstoff steht dann nicht mehr für die Verbrennung zur Verfügung. Die höchsten Temperaturen entstehen aber nun einmal bei optimaler Verbrennung, so dass die beste Verbrennung mit den höchsten CO2-Werten
im leicht mageren Bereich bei l
~1,1 liegt.
Die kleinen Einzelhubräume von Motorrad- oder 12-Zylindermotoren weisen jedoch ein sehr günstiges Verhältnis von küh- lender Zylinderfläche zum heissem Innenraum auf, so dass im
Vergleich zu “Dosenmotoren” mit sehr grossen Einzel- hubräumen sehr wenig NO entsteht.
Im fetten Bereich findet man dagegen stark ansteigende CO-Werte, weil das
Sauerstoffangebot nicht ausreicht um den Sprit vollständig zu verbrennen. Gleichzeitig steigt auch der Anteil unverbrannten Sprits, der als Bruchstücke der Kohlen- wasserstoffe (HC) und als Wasserstoff H2 zum Auspuff heraus kommt. Der Anstieg der HC-Werte bei sehr magerer Einstellung
l >1,2 zeigt ebenfalls, dass hier die Verbrennung wieder unvollständig wird.
Die Grafik zeigt die prozentuale Zusammensetzung des Abgases durch die Verbrennungsbedingungen. Wieviel Schadstoffe absolut aus dem Auspuff kommen werden, wird durch den Spritverbrauch bestimmt.
Dazu einmal eine einfache Abschätzung: Bei einem Lambda-Wert von l =0,85 hat man einen CO-Gehalt von rund 2 Vol%, das Volumenverhältnis liegt bei diesem
l
bei etwa 7500:1, also 7500 Liter Luft pro Liter Sprit. Bei einem Spritverbrauch von rund 6 l/100 km ergibt sich ein Gemischdurchsatz von
|
|
etwa 450 l/km, die
auch zum Auspuff heraus kommen. Der Volumenanteil von 2 % CO bedeutet dann 9 Liter CO, das mit einer Dichte von etwa 1,23 g/l einen CO-Ausstoss von 11 g/km ergibt. Stimmt man nun diesen Motor auf einen
Lambda-Wert von l
=1,1 ab, so würde der gleiche Gemischdurchsatz zu einem Verbrauch von ~4,5 l/100 km führen, für die gleiche Leistung am Rad muss man jedoch die Drosselklappen weiter öffnen, so dass sich etwa ein Verbrauch von 5,5 l/100 km und ein Gemischdurchsatz von 550 Liter pro km ergibt. Der CO-Gehalt bei
l
=1,1 liegt bei etwa 0,1 Vol%, der absolute Ausstoss damit bei 0,7 g/km.
Achtung: Dieser mittlere Ausstoss ist nur bedingt mit denen im ECE R40-Zyklus ermittelten Werten vergleichbar. Dieser Zyklus
simuliert einen sehr langsamen innerstädtischen Stop-and-go-Verkehr, bei dem die Motoren zugunsten eines guten Rundlaufs (s.u.) recht fett abgestimmt werden.
Bei den anderen Schadstoffen kann man den
mittleren Ausstoss äquivalent abschätzen, jedoch kommen bei den HC-Werten noch die sogenannten Spülverluste hinzu, die für erhöhte Werte sorgen wenn
unverbrannter Sprit während der Ventilüber- schneidung in den Auspuff gelangt.
Die geringsten Spülverluste weist ein Motor im Bereich des max. Drehmoments auf. Auf Leistung ausgelegte Sportmotoren
mit weitem Drehzahlbereich haben besonders im unteren Drehzahlbereich sehr hohe Spülverluste. Randbemerkung: Katalysator
Im Katalysator werden die Schadstoffe an einer Platin-Schicht nachoxidiert. Er
wandelt CO in CO2, NO in N2 und O2 und HC in H2O und CO2 um. Für alle drei Schadstoffe (3-Wege-Kat) klappt das aber nur in einem sehr schmalen Katalysatorfenster bei
l =1 +/- 0,005.
Nachteil dabei ist
natürlich, dass grade in diesem Bereich weder die optimale Leistung, noch der beste Wirkungsgrad erreicht werden.
Gegenüber einem gut abgestimmten Motor wird beim Beschleunigen daher weniger
Leistung zur Verfügung stehen und bei normaler Fahrt wird er mehr Benzin verbrauchen.
Ein ungeregelter Kat an einem auf Leistung (fett) abgestimmten Fahrzeug wird dagegen hauptsächlich die eh sehr
geringen NO-Werte senken und die hohen HC-Werte nur geringfügig verbessern können. Bei den CO-Werten ist er ziemlich nutzlos.
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
Die Abstimmung mittels
Lambda-Anzeige
|
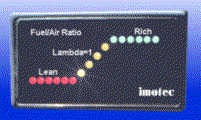
|
Ok, vor Erfindung der Lambdasonde, wurde die Abstimmung anhand der Zündkerzenfarbe gemacht. Jetzt geht das einfacher und permanent. Die Abstimmung mittels Lambda-Anzeige
vereinigt viele Vorteile in sich.
|
|
|
|
|
|
|
Der
grösste Vorteil sind die ausserordentlich geringen Kosten, mit denen man eine ordentliche Motorabstimmung ordentlich hinbekommen kann, sowie die permanente Motorüberwachung.
Die Abstimmung,
insbesondere im Teillastbereich, hängt von der verwendeten Vergaser- bzw. Einspritzanlage und den persönlichen Vorlieben ab.
Technisch ist nur die Abstimmung im Leerlauf und bei der maximalen
Leistung, also bei hoher Drehzahl und Vollgas vorgegeben. Dazwischen ist man, je nach Vergaser- bzw. Einspritzanlagentyp, in der Abstimmung relativ frei.
|
|
|
Leerlauf:
|
Hier hat man aufgrund
der sehr langsamen Strömungsgeschwindigkeit im Ansaugkanal mit sehr schlechter Gemischbildung und daher unvollständiger Verbrennung zu kämpfen, so dass das Gemisch etwas angefettet werden muss. Ein
Lambdawert von l
~0,85 entspricht dabei noch den üblichen CO-Vorschriften. Eine etwas fettere Einstellung von l ~0,8 kann aber zu einem besseren Startverhalten und Rundlauf führen.
|
|
Aus diesen Grenzwerten
und dem Leistungskriterium ergibt sich der Vollast-Verlauf, der mit einem gleichmässigen Lambda-Wert von l ~0,85-0,90 für viel Leistung sorgt.
Jedoch arbeitet der Motor ja bei l
~ 1,1 am wirtschaftlichsten, da hier der optimale Wirkungsgrad erreicht wird. Deshalb kann im mittleren Drehzahlbereich, also im Bereich des maximalen Drehmoments, und bei Teillast das Gemisch magerer eingestellt werden. Der Motor dankt es einem mit einem geringeren Spritverbrauch und besseren Abgaswerten.
|
|
|
Vorlast:
|
Hier sollte das
Gemisch ebenfalls etwas fetter sein um die Verbrennungstemperatur abzusenken. Ausserdem gibt der Motor ja bei einem Lambdawert von l ~0,85 seine beste Leistung ab.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
1) Wo wird ein Vergaser-
motor abgestimmt
Exemplarisch seien an einem Weber-Doppelvergaser diejenigen Teile gezeigt, an denen eine Vergaserabstimmung im Wesentlichen vorgenommen
wird. Wie gesagt, im Wesentlichen.
|
|
|
|
|
|
|
|
1 =
|
Mischrohr
|
|
2 =
|
Hauptdüse
|
|
3 =
|
Luftkorrekturdüse
|
|
4 =
|
Leerlaufdüse
|
|
5 =
|
Lufttrichter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bei Schiebervergasern
und Einspritzanlagen ist man freier in der Einstellung. Hier sollte der Teillastbereich deutlich magerer abgestimmt werden, dafür aber bei Vollgas in allen Drehzahlbereichen ein Lambda-Wert von l ~0,85 beibehalten werden.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bei Schiebervergasern
und Einspritzanlagen ist man freier in der Einstellung. Hier sollte der Teillastbereich deutlich magerer abgestimmt werden, dafür aber bei Vollgas in allen Drehzahlbereichen ein Lambda-Wert von l ~0,85 beibehalten werden.
|
|
Gleichdruckvergaser
hingegen können jedoch nicht zwischen den
Lastzuständen unterscheiden. Die Schieberöffnung wird nur durch die Ansaugströmung bestimmt, die von dem Drosselklappenwinkel und Drehzahl abhängt. Halbgas bei maximaler Drehzahl führt zu einer identischen Schieberstellung wie Vollgas bei mittlerer Drehzahl. Daher muss hier ein Kompromiss zwischen guter Beschleunigung aus mittleren Drehzahlen (
l
<1) und geringen Spritverbrauch und gute Abgaswerte (l >1) gefällt werden, der meist um l
~0,9 liegt. Aus diesem Kompromiss ergeben sich auch die recht schlechten Abgaswerte bei CO und HC der heutigen Motoren, die meist mit Gleichdruckvergasern ausgestattet sind.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Auf die
Abstimmung haben je nach Last verschiedenen Elemente des Vergasers Einfluss. Diese Grafik zeigt den Zusammenhang schematisch für einen Gleichdruckvergaser.
Bei
Schieber- bzw. Drosselklkappenvergasern, die mit variabler Strömung im Ansaugtrakt zu kämpfen haben, wirken sich noch die Verhältnisse zwischen Sprit- und Luftdüsen in den
jeweiligen Bereichen aus.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
2) Wo wird ein Einspritz-
motor ohne Katalysator
abgestimmt
Bei einem ungeregelten Einspritzmotor funktioniert die Motorabstimmung ähnlich, nur an anderer Stelle. Auch hier
sollte der
Teillastbereich deutlich magerer abgestimmt werden, dafür aber bei Vollgas in allen Drehzahlbereichen ein Lambda-Wert von l ~0,87 beibehalten werden.
Bei einem Motor ohne geregelten KAT, also beispielsweise Motoren mit L-, oder LE-Jectronic, erfolgt die Motorabstimmung rein mechanisch über:
|
|
Bei diesen Motoren wird zuerst mit der Abstimmung des Vollastbereiches über den Abgleich des Benzindruckes begonnen. Hier sind die meisten
geänderten Motoren zu “mager” abgestimmt, mit der Folge einer zu heissen Verbrennung. Dieses würde dann in aller Regel zu Abschmelzungen am Kolben führen und somit unweigerlich zu einem kapitalen
Motorschaden.
Daher also zunächst rauf mit dem Druck. Soweit hoch, bis das die Lambda-Anzeige den gewünschten Wert (unter Last) von etwa l
~0,87 anzeigt. Hierzu sollte der Motor einige Sekunden unter Vollast laufen, bis das sich der endgültige Wert auf dem Display einregelt und ablesen lässt.
|
|
|
|
|
|
|
|
a) den Benzindruck, als Hauptkenngrösse für den
gesamten Drehzahlbereich mit Hauptaugenmerk
auf den Vollastbereich die Federvorspannung der
Stauklappe im Luftmengenmesser
zur Feinabstimmung des Teillastbereiches und der
Beschleungungsanreicherung
c) die Bypassschraube im Luftmengenmesser zur
Feinabstimmung des Leerlaufbereiches.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sollte es für eine
passende Motorabstimmung nötig sein, den Druck um mehr als 1 Bar zu erhöhen, sollte ernsthaft über grössere Einspritzdüsen nachgedacht werden, weil sonst
der Einspritz-Strahl zu stark in sich gebunden ist und eine Gemischverwirbelung nicht mehr ausreichend erfolgen kann. Die Folge daraus ist dann ein unnötig hoher Spritverbrauch und trotzdem noch nicht die höchste
|
|
|
|
|
bzw. das max.
Drehmoment. Oder anders betrachtet: Die passende Menge Sprit würde dann zwar “reingegossen”, aber nicht mehr zu 100% verwirbelt, mit der genannten Folge.
Nachdem der Vollastbereich passt, kann
jetzt nach persönlicher Vorliebe der Teillastbereich abgestimmt werden. Je nach Belieben etwas fetter oder halt etwas magerer, ohne fatale Folgen.
Zu allerletzt wird die Leerlaufabstimmung
vorgenommen und für einen ordentlichen Rundlauf auf etwa l~0,85 eingeregelt, welches einem CO-Gehalt von rund 2 Vol% entspricht.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
3) Wo wird ein Einspritzmotor
mit geregeltem Katalysator
abgestimmt
Bei
einem geregelten Einspritzmotor funktioniert die Motorabstimmung ähnlich, nur an anderer Stelle.
Womit ein Motor mit geregeltem KAT abgestimmt wird, finden Sie detailliert hier: Mehr...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
4) Zündeinstellung -> wichtig
bei der Motorabstimmung
|
|
|
|
|
Um ein
leistungsträchtiges Gemisch ordentlich zu entflammen, ist zunächst einmal eine Hochleistungs-Zündanlage, wie zumindest beispielsweise die BOSCH TSZ-H mit entsprechender Zündspule eine wichtige
Voraussetzung (Zündanlagen-Übersicht). Was nutzt das beste
Gemisch, wenn es die Zündanlage nicht ordentlich entzünden kann.
Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, muss, neben der passenden Spritqualität, parallel zur Motorabstimmung die richtige
Zündeinstellung vorgenommen werden.
Als Grundsatz hierfür gilt: Einstellung auf die Klingelgrenze, minus 1°. Das 1° als Sicherheitsreserve vom optimalen Zünd- winkel abgezogen einstellen, um die
Toleranzen bei der Spritqualität mit auszugleichen.
Das “Motorklingeln” ist ein Klopfgeräusch, welches durch eine Selbstentzündung des Gemischen entsteht. Dieses Klopfen ist von aussen als
“Klingeln” hörbar. Zu Selbstentzündungen bzw. “Klingeln” kann es durch einen zu früh eingestellten Zündzeitpunkt, schlechte Spritqualität, oder einfach durch Sprit mit einer zu niedrigen Oktanzahl
kommen.
|
|
Egal wie - klingeln killt den Motor !
Die Klopfgeräusche entstehen dadurch, dass die Selbstentzündung mit
Schallgeschwindigkeit im Brennraum abläuft. Die Selbstentzündung läuft zudem mit hohen Druckspitzen (siehe Diagramm) ab, welche den Kolben zerstören können und Zuende ist es mit dem Motor !
Nochmals
- man darf ja viel mit einem Motor anstellen, aber klingeln, klingeln darf er nicht!
Klingeln bzw. Klopfen - das tötet ihn !!! Mehr...
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
5) Abstimmwerkzeuge/Ab-
stimminstrumente
Gutes Werkzeug ist, wie immer, die Basis zum Erfolg.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lambda-Anzeige:
Der Lambda-Indicator
|
|
Das Basiswerkzeug
für alle Motoren:
Die Lambdasonde
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Werkzeuge für die Vergaserabstimmung
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Düsenreibahlen und Düsenlehren
|

|
Unterdruckuhren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2) Werkzeuge für Einspritzmotoren ohne KAT
|
|
4) Werkzeuge für die Zündung
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
einstellbarer Benzindruckregler
|
|
Zündfunkentester
|
Stroboskoplampe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3) Werkzeuge für Einspritzmotoren mit geregeltem
KAT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
entweder
fertig abgestimmtes Eprom,
|
oder

oder einstellbarer
POWER-PROVIDER |
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
Zusammenfassung
Die Motorabstimmung ist das “A und O” beim Motorenbau ! Ohne Abstimmung geht nix - gar nix !!!
Weder bezüglich der Leistung noch der Haltbarkeit.
Zusammenfassend ist festzuhalten:
die beste Leistung gibt es bei l~0,85-0,87 das am besten zu reinigende Abgas bei l1 +/- 0,005 den besten Wirkungsgrad gibt es bei l~1,1
So - wenn das alles
beachtet und sorgfältig durchgeführt wurde, hat der Motor, egal welcher, seine ideale Leistung mit einem perfekten Drehmomentverlauf und jetzt wird er halten !
Zum Inhaltsverzeichnis  |
|
|
|
|
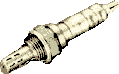

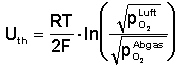 zwischen den Elektroden (Nernst-Gleichung), die direkt gemessen werden kann. Und was gemessen werden kann, dass ...
zwischen den Elektroden (Nernst-Gleichung), die direkt gemessen werden kann. Und was gemessen werden kann, dass ...